Die Kraft der Empörung
Wer sich ungerecht behandelt fühlt und sich darum widerspenstig verhält, spürt etwas, das stärker ist als jeder materielle Nutzen: nämlich Selbstachtung. Diese Ressource sollten wir nutzen – gerade in der Sozialen Arbeit.

Von Michael Herzig
Einmal pro Semester unterrichte ich zusammen mit einem Mann, der Sozialarbeiter:innen an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen kann: Roger Hochuli ist Sozialarbeitsexperte aus Erfahrung, er lebt in einem betreuten Wohnen, hat seit Langem eine Beistandschaft, bezieht jede Woche ärztlich verschriebenes Heroin in einer Klinik und arbeitet stundenweise in einem Beschäftigungsprogramm.
Er hat viel erlebt und ist davon gezeichnet. In unserem gemeinsamen Unterricht wollen wir angehende Sozialarbeiter:innen ermutigen, bockiges Verhalten ihrer Adressat:innen schätzen zu lernen. Reaktanz, wie Widerspenstigkeit im Fachjargon heisst, lässt sich nicht durch Regeln und Sanktionen unterbinden. Eine sozialarbeiterische Interaktion sollte nämlich nicht mit bürokratischer Machtausübung beginnen, sondern mit der ehrlichen Absicht, das Gegenüber mit all seinen Stärken und Schwächen, Ecken und Kanten verstehen zu wollen.
Erst einmal zuhören
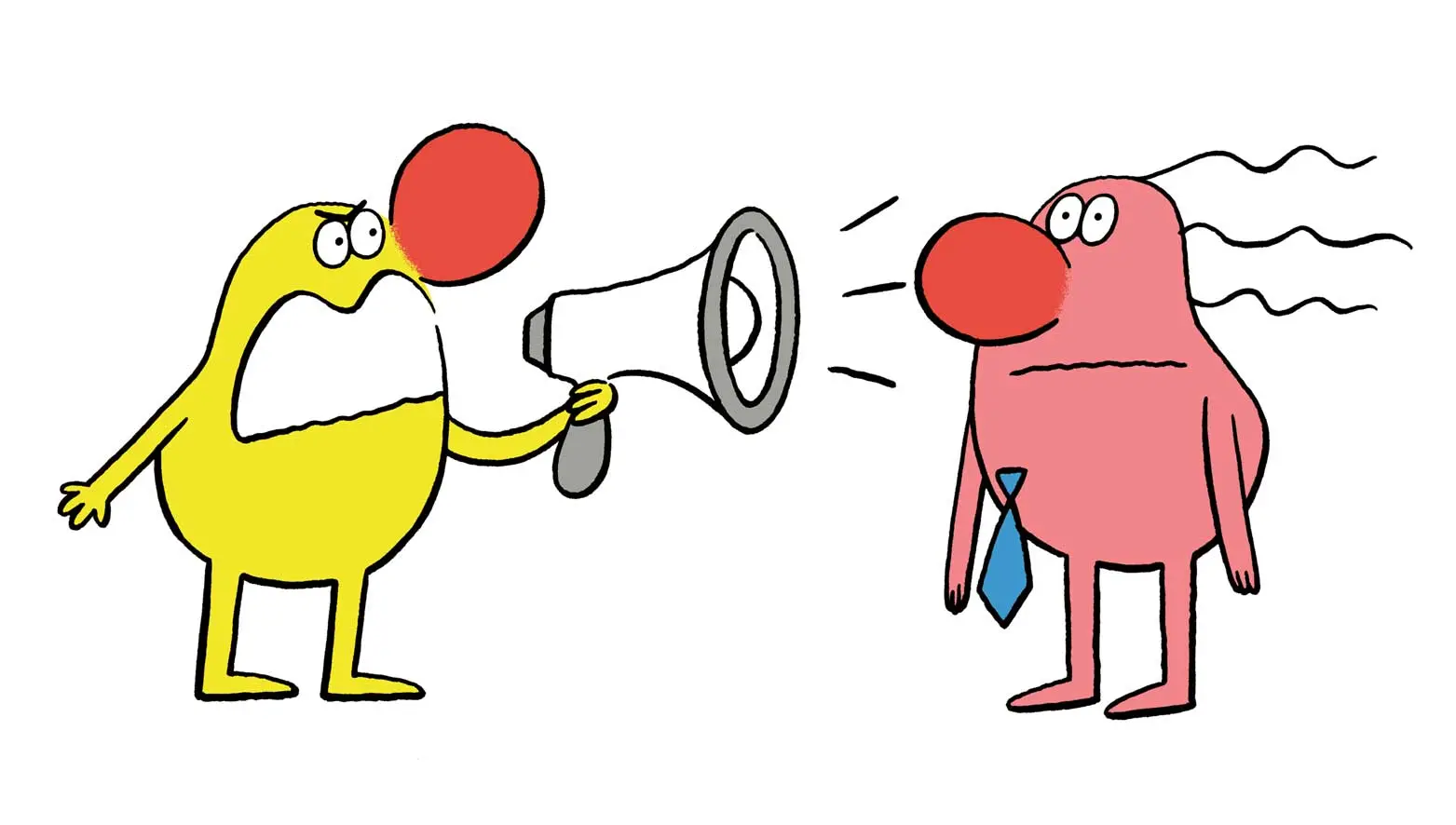
Mein Co-Dozent hat in seinem Leben viele Kämpfe ausgefochten und die meisten davon verloren. Allerdings bloss aus meiner Sicht. Rogers Augen glänzen nämlich, wenn er von seinem Tom-und-Jerry-Spiel mit einem Heimleiter erzählt, einem autoritären Patron alter Schule, den er bis aufs Blut reizte und der ihn für seine Respektlosigkeiten, Provokationen und Tricksereien immer wieder bestrafte.
Das Spiel endete vor einem Staatsanwalt, der das tat, was der Sozialarbeiter vernachlässigt hatte: Er hörte zunächst einmal zu. Weil der Beschuldigte glaubhaft versichern konnte, dass er bloss gedroht hatte, das Angedrohte aber nicht in die Tat umgesetzt hätte, blitzte der Heimleiter mit seiner Klage ab. Das Verfahren wurde eingestellt.
Als Roger von der Anhörung bei der Staatsanwaltschaft ins Heim zurückkehrte, war er obdachlos, seine Habseligkeiten waren eingelagert. Er stand auf der Strasse mit nichts als seinen Kleidern am Leib. «Ich habe gewonnen, indem ich verloren habe», meint er dazu. «Ich war die Maus, aber die Katze hat mich nicht erwischt.»
Das Ziel: handlungsfähig bleiben
Wenn ich Roger frage, was ihn immer wieder dazu anstachle, Widerstand zu leisten, nennt er zwei Gründe: erstens unsinnige Regeln, zweitens Machtmissbrauch. Vorschriften, Abläufe und Formulare, deren Nutzen nicht nachvollziehbar ist, werden schnell einmal als Schikane empfunden, weil sie Ohnmachtsgefühle auslösen. Sie stehen am Anfang einer Reihe von Demütigungen, im Laufe derer Menschen nicht wahrgenommen, bewusst ignoriert, zum Schweigen gebracht, manipuliert, ausgeschlossen, diskriminiert oder verletzt werden.
Das kann zum Widerstand anstacheln. In der Emotionspsychologie ist Empörung im Unterschied zu blinder Wut moralisch aufgeladen: Es ist das Gefühl der ungerecht Behandelten und der Unterdrückten. Die Empörten sehen sich selbst im Recht, was sie dazu legitimiert, aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Normen zu brechen und gegen Konventionen zu verstossen, die sie als unterdrückend empfinden.
Empörung folgt Täter-Opfer-Logik
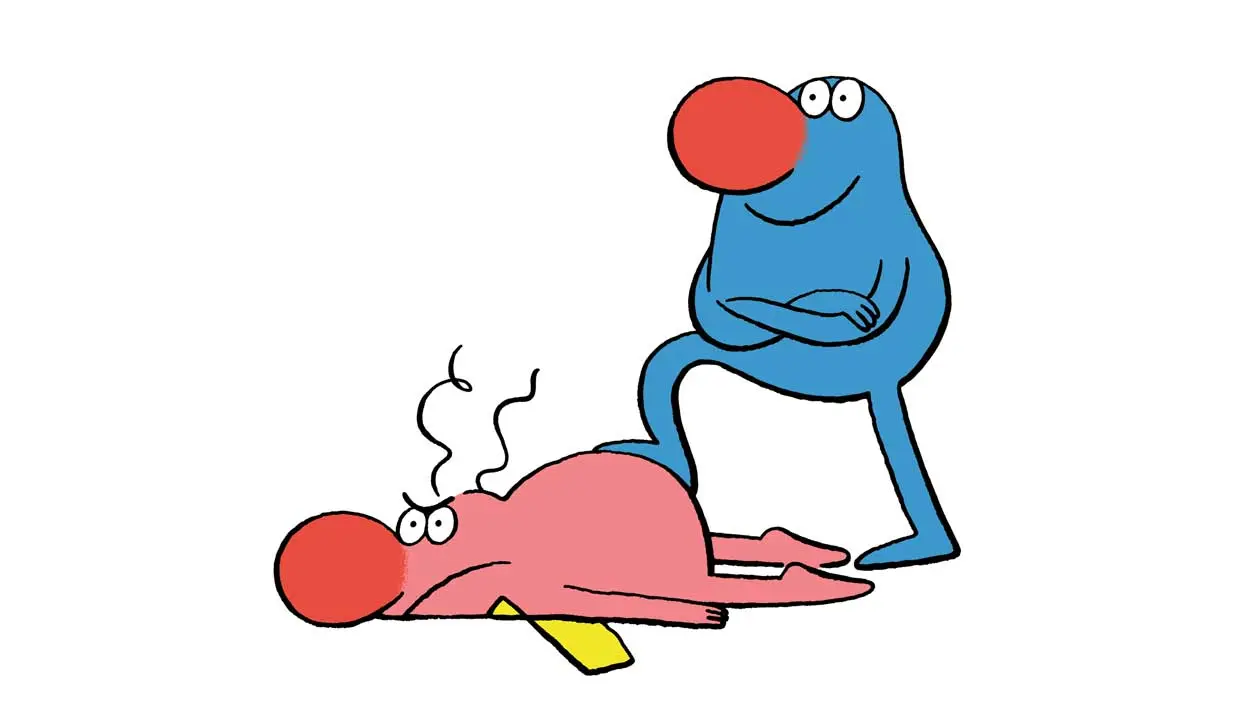
Dabei spielt es keine Rolle, ob die anderen diese Empörung für legitim halten oder nicht, ob sie eine sachliche Grundlage hat oder nicht, ob sie zum Erfolg führt oder geradewegs in den Abgrund. Die Empörung gibt den Empörten etwas, was stärker ist als jeder materielle Nutzen: Selbstachtung.
Das Wesen der Empörung ist eine Täter-Opfer-Logik. «Die Wahrnehmung und Bewertung eines Akteurs und seines Handelns löst beim Gefühlssubjekt Empörung aus, woraufhin es sich gegen den Normenverstoss auflehnt.» So nüchtern beschreibt die Psychologin Dorothee Elisabeth Kalisch in ihrem 2007 erschienenen Buch «Empörung. Psychologische Grundlagen ihrer Veränderung» einen hochemotionalen Vorgang, der unter anderem erklärt, weshalb mein Co-Dozent sich in aussichtslose Machtkämpfe mit Heimleitern und Beiständinnen verkeilte.
Es ist in solchen Situationen nicht das primäre Ziel, eine Auseinandersetzung zu gewinnen. Vielmehr geht es darum, sich selbst als handlungsfähig zu erleben. Die Empörung bewahrt einen davor, sich selbst aufzugeben. Sie ist egozentrisch, weil das Ich auf dem Spiel steht. In solchen Momenten sich selbst zu reflektieren oder sich in andere hineinzufühlen, fällt schwer. Der moralische Impetus erstickt jede dialogische Regung. Die Empörung ist der Treibstoff der Selbstverteidigung und der Abwehrschlacht, nicht der Verhandlung und des Kompromisses.
Brandmauern werden hochgezogen
Wenn Empörung auf Empörung prallt, gerät das «Karussell der Empörung» in Schwung, wie es der deutsche Psychologe und Psychotherapeut Arist von Schlippe in seinem gleichnamigen Buch von 2022 nennt. Die sachlichen Gründe für eine Auseinandersetzung gerieten zunehmend in den Hintergrund, schreibt er dort. Aus der Erwartung heraus, dass einen das Gegenüber abwerte, werde es selbst abgewertet. Pauschalisierende Aussagen würden den Dialog ersetzen.
Zuhören erübrige sich, weil beide Parteien zu wissen glaubten, was die andere sagen werde. Und selbst wenn dem nicht so sei, wenn eine Partei sogar Verständnis für die Position der anderen äussere, werde dies häufig gar nicht gehört. «Ein Konflikt ist eine bestimmte Form der Abfolge von Kommunikationen, die darin besteht, dass Kommunikation mit einer Negation beantwortet wird und auf diese wieder eine Negation folgt», schreibt Arist von Schlippe. Anders gesagt: Diese Art von Kommunikation verhindert Verständigung, Schützengräben werden ausgehoben und Brandmauern hochgezogen.
Ignorieren ist eine Aggression
Das Letzte, durch das diese Eskalation gebremst werden kann, sind Anstandsregeln. Der anderen Seite vorzuschreiben, wie sie sich gefälligst zu benehmen habe, welche Terminologie korrekterweise verwendet werden dürfe und welche nicht, bringt das Blut erst recht in Wallung.
Wer Normen durchsetzen will, um Empörung zu vermindern, vernachlässigt den Umstand, dass die Empörung durch eine empfundene Normenverletzung entstanden ist. Es ist nicht zweckmässig, von einer Person Respekt einzufordern, die sich überhaupt nicht respektiert fühlt. Wenn eine halbwegs gewaltfreie Lösung erreicht werden soll, wird eine Partei früher oder später versuchen müssen, die andere so zu akzeptieren, wie sie ist.
Empörung ist eine Ressource
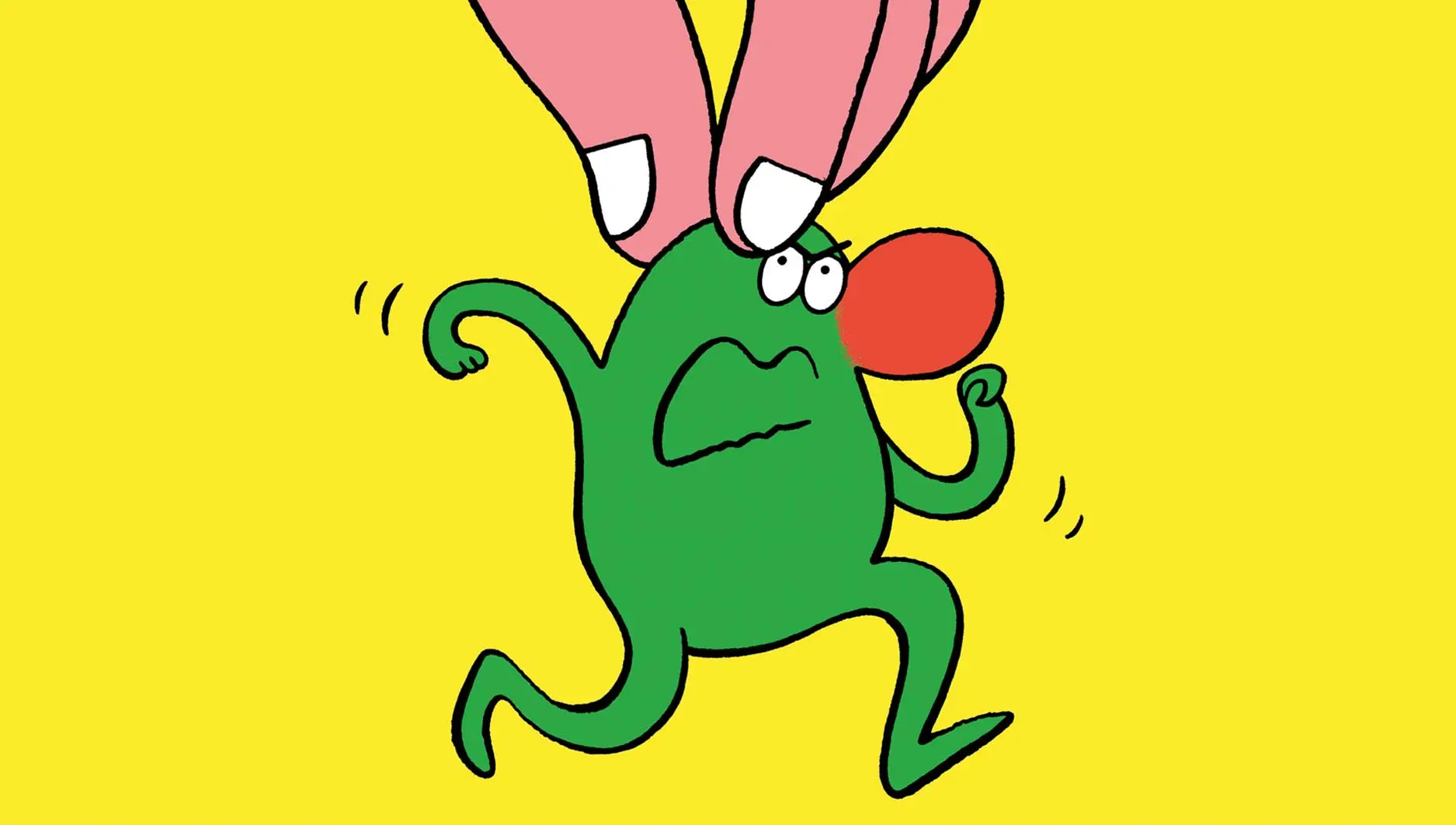
Im Idealfall beginnt die Seite damit, die mehr Macht hat. Eine ebenso ungeeignete Strategie ist es, die Empörten zu ignorieren. Ignoranz ist die Negation der Existenz der anderen. Auch wenn es nicht so aussehen mag, ist das Ignorieren aus Sicht der Ignorierten eine höchst aggressive Handlung. Die Ignorierenden sehen sich dagegen kaum als Täter:innen. Dennoch führt ihr Verhalten zum Beziehungsabbruch.
Das kenne ich von mir selbst: Solange ich mich über jemanden nerve, liegt mir die Beziehung zu dieser Person noch am Herzen. Wenn ich aber mit meinem Ärger erfolglos anrenne, ohne dass das Gegenüber reagiert, wächst in mir die Gleichgültigkeit. Auf ihrem Höhepunkt ist sie absolut. Es ist, als wenn die andere Person nicht mehr existieren würde. Ende, aus.
Das Gegenteil von Gefühl ist Gefühllosigkeit. So betrachtet, ist Empörung eine Ressource, die sowohl konstruktiv als auch destruktiv eingesetzt werden kann. In welche Richtung sie Fahrt aufnehmen könnte, deutet ein anderes Gefühl an: Angst.
Unsicherheit erzeugt Angst
Im Essay «The Spectre of Insecurity», erschienen im Online-Magazin «Aeon», lotet Jennifer Morton die politische Bedeutung von Unsicherheit aus. Der Liberalismus und die liberale Demokratie westlicher Prägung schaffe Instabilität und Unsicherheit für alle, auf dass gemäss dem liberalen Mantra die Geschäftstüchtigen sich durchsetzen mögen, schreibt die US-amerikanische Philosophin, die an der University of Pennsylvania lehrt.
Wer versage, gelte als selbst schuld, im liberalen Sprachgebrauch als eigenverantwortlich. Die so erzeugte Existenzangst verdränge Werte wie Freiheit, Chancengleichheit und Gleichberechtigung, die für die Menschen zunehmend zu leeren Phrasen würden, wie Morton erläutert. Darum fänden in wirtschaftsliberal geprägten Gesellschaften autoritäre Politiker:innen Gehör, deren Programm auf Sicherheit und (National-)Stolz basiere.
AfD zieht unglückliche Menschen an
Unsicherheit erzeugt Angst, Ungerechtigkeit erzeugt Empörung. Roger Hochuli erlebte sich in seiner Empörung als selbstwirksam, weil er keine Angst vor der Obdachlosigkeit hatte, denn diese kannte er bereits. Seine Würde zu bewahren, war ihm wichtiger. Wie aber geht es denjenigen Empörten, die mehr zu verlieren haben?
Die Ökonomin Maja Adena und der Ökonom Steffen Huck führten am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung zwischen 2019 und 2021 eine Befragung durch, um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen Parteizugehörigkeit und Wohlbefinden gebe. Ihr Fazit: Die AfD ziehe unglückliche Menschen an, mache sie aber nicht glücklicher; erst der Parteiaustritt erhöhe das Wohlbefinden wieder.
Aufwertung des Selbst
Adena und Huck erklären diesen Befund damit, dass die AfD durch das Bewirtschaften negativer Themen negative Gefühle erzeuge. Sie raten den anderen Parteien, auf positive Inhalte zu setzen, um nicht selbst in diesen Negativstrudel zu geraten.
Aus einer sozialarbeiterischen Perspektive greift mir diese Erklärung zu kurz, weil sie die Kraft der Empörung unterschätzt. Es reicht nicht aus, positive Themen zu betonen. Wer sich gedemütigt fühlt, muss die Selbstachtung zurückgewinnen. Das braucht nicht zwingend über Feindbilder und Vorurteile zu erfolgen, die sich politisch instrumentalisieren lassen.
Natürlich finden Ressentiments und Hass im aktuellen gesellschaftlichen Klima dankbare Abnehmer:innen. Wenn ich die Empörten aber nicht bloss als Figuren auf einem Schachbrett betrachten will, muss ich verstehen, dass hinter der Abwertung anderer Menschen das Bedürfnis nach Aufwertung des Selbst liegt. Erst, wenn Menschen sich selbst achten können, ohne andere zu missachten, macht Empörung glücklich.
Glück ist kein Nullsummenspiel
Ein erster Schritt in diese Richtung wäre, damit aufzuhören, sich selbst dauernd mit anderen zu vergleichen. Kein Naturgesetz besagt, dass es uns ausschliesslich dann gut gehen kann, wenn es anderen schlechter geht. Zwar ist materieller Wohlstand bis zu einem gewissen Grad auch eine Frage der Verteilung, jedoch müssen nicht alle Menschen gleich viel besitzen, um glücklich zu sein. Grundbedürfnisse sollten allerdings schon gedeckt werden können, denn sonst gedeiht nicht nur die Empörung, sondern auch die Angst.
Ein weiterer Schritt könnte darin bestehen, in anderen Menschen nicht grundsätzlich die Konkurrenz und die Bedrohung zu suchen, sondern das Kooperationspotenzial entdecken zu wollen. Glück ist kein Nullsummenspiel, und Gefühle sind wie Wissen: Sie vermehren sich, wenn sie geteilt werden.
Zum Autor

Michael Herzig leitete viele Jahre die Suchthilfe der Stadt Zürich. Heute berät er soziale Organisationen, ist Dozent an der ZHAW Soziale Arbeit, Experte für Drogenpolitik und Autor. Zuletzt erschien von ihm das Buch «Landstrassenkind: Die Geschichte von Christian und Mariella Mehr» (Limmat-Verlag).