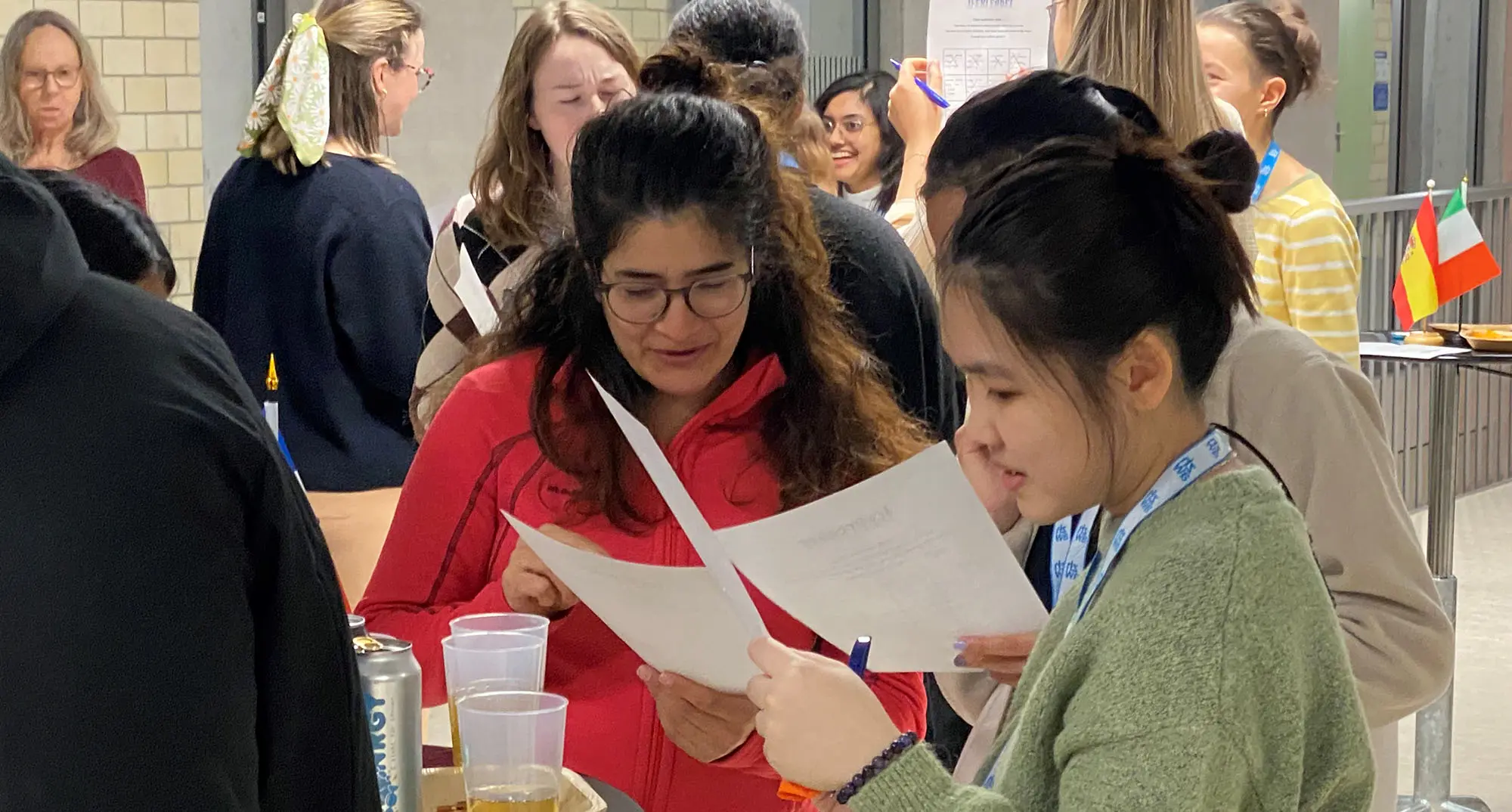Winter School: «Die Studierenden überraschen mich immer wieder mit kreativen und humorvollen Arbeiten.»
Der Linguist David Stamm unterrichtet bereits zum sechsten Mal an der Winter School das englischsprachige Modul «Diversity in Health Professions». Im Interview berichtet er von den vielen spielerischen Elementen des Unterrichts, wie der Oscar Show oder der «Modulprüfung» in Form eines Spiels.
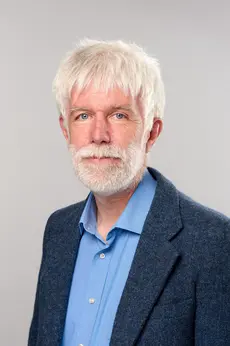
«Wir haben ein kollegiales Verhältnis zu den Studierenden, das schätzen sie sehr.» David Stamm, Dozent Winter School
David Stamm, aus welchen Ländern kommen die Studierenden an die Winter School?
Von unseren Partneruniversitäten auf der ganzen Welt, zum Beispiel aus Singapur, Indien, den USA, von Europa aus Belgien, Deutschland, Finnland, Griechenland oder den Niederlanden. Die Winter School hat einen guten Ruf. So erzählten mir drei Studierende aus Deutschland, dass sie viel Gutes über die Winter School gehört haben und sie deshalb hier seien. Von der indischen Universität kommen jeweils die Jahrgangsbesten.
Erzählen Sie von dem Modul Diversity.
Diversity ist ein sehr breites Thema. Wir gehen es aus einer interkulturellen Perspektive an. Neben den 30 Studierenden aus dem Ausland, besuchen pro Woche rund 60 Studierende der ZHAW das Modul. Sie sind im fünften Semester und haben eben ihr grosses Praktikum absolviert. Das ist ein guter Moment, über kulturelle Unterschiede zu sprechen. Alle hatten Erlebnisse zu dem Thema, haben Diskriminierungen beobachtet oder Missverständnisse wegen ungenügender Kommunikation erlebt, sogenannte critical incidents. Diese besprechen die Studierenden in Kleingruppen und machen zusammen dazu ein Video. Das ist auch für mich eine sehr spannende Aufgabe: Denn immer wieder überraschen mich Studierende mit kreativen humorvollen Videos.
Was gefällt dir besonders am Unterrichten an der Winter School?
Die heterogene Gruppe ist spannend. Das Modul mache ich jeweils zusammen mit Susan Schärli-Lim und drei externen Dozierenden. Dieses Jahr unterstützt uns zusätzlich eine Kollegin aus Belgien. Das Konzept für dieses Modul haben wir von meinem Vorgänger Samuel van den Bergh übernommen und wir finden es auch nach der insgesamt elften Durchführung gelungen.
Herausfordernd ist, dass ich die wenigsten Studierenden von früheren Modulen her kenne. Deshalb ist es wichtig, bereits am ersten Tag eine gute Atmosphäre zu schaffen.
Wie macht ihr das?
Wir machen viel Interaktives und nehmen uns Zeit für den mündlichen Austausch. Wir starten mit einem Spiel und versuchen jeden Tag weitere spielerische Elemente einzubauen. Am Donnerstag ist die Oscar Show. Zuerst schauen wir im Klassenverband die fünf Videos der Klasse an und wählen das Beste aus. Dieses kommt dann ins Finale aller Klassen, an die sogenannte Oscar Show. Da machen wir eine richtige Show daraus, das ist immer sehr lustig. Wir tragen elegante Kleider, meine Kollegin Susan Schärli-Lim ein Kleid mit Diadem, ich einen Anzug mit Fliege. Eine Studierende war dieses Jahr als Diva gekleidet und trug einen Pelzmantel.
Wie wird das Modul bewertet?
Statt einer Modulprüfung prüfen wir das erlernte Wissen am Schluss der Woche mit einem Spiel. Als Leistungsnachweise bewerten wir das Video und den «Critical Incident», den Bericht der Studierenden über eine Situation, die sie selbst erlebt und analysiert haben. Wichtig ist, dass die Studierenden zeigen, dass sie die gelernten Theorien in praktischen Situationen anwenden können. Für das Modul erhalten die Studierenden 2 ECTS. So viele Menschen zusammenzuführen, macht viel Spass, ist aber auch anstrengend. Zusammen mit den Korrekturen des Leistungsnachweises und dem sozialen Teil sind das jeweils zwei vollgepackte Wochen für mich.
Was schätzen die Gäste besonders an der Schweiz?
Oft werde ich gefragt, ob in der Schweiz immer so spielerisch unterrichtet wird. Aber das ist auch für uns eine Ausnahme. Wir haben ein kollegiales Verhältnis zu den Studierenden, das schätzen sie sehr. Wir alle stellen uns jeweils mit unserem Vornamen vor. Das ist ein gutes Beispiel für kulturelle Unterschiede. Für die Studierenden aus Singapur sind solch flache Hierarchien unvorstellbar. Deshalb sprechen sie mich mit «Professor» an.
Viele sind beeindruckt von unserem Gebäude und der Infrastruktur. An vielen Orten auf der Welt, wie zum Beispiel in Grossbritannien oder den USA, haben öffentliche Fachhochschulen sehr knappe finanzielle Mittel. Solch moderne Gebäude können sich meist nur private Anbieter leisten.
Besonders schön finde ich die Rückmeldung von zwei Studierenden in der Feedbackrunde am Ende des Moduls zur Frage über «The most important thing that I learned». Sie antworteten «I met the love of my life». Von einem Paar, das sich vor ein paar Jahren an der Winter School kennen lernte, weiss ich, dass sie mittlerweile geheiratet haben.